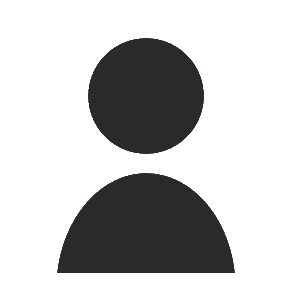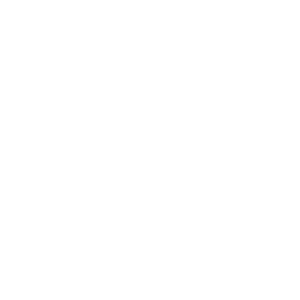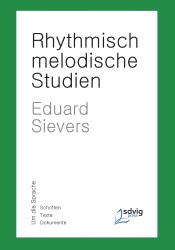This document is unfortunately not available for download at the moment.
Über ein neues Hilfsmittel philologischer Kritik
Eduard Sievers
pp. 135-162
1Vor nunmehr zehn Jahren habe ich in einem Vortrag auf der Wiener Philologenversammlung einen ersten Versuch gemacht, die Wichtigkeit der auf den natürlichen Sprachmelodien sich auf bauenden Melodien des gesprochenen Verses für die Charakteristik der Versbildung darzulegen. Die hiermit angeschnittene Frage nach der Bedeutung und Verwertbarkeit der melodischen Elemente der menschlichen Rede habe ich sodann in der Zwischenzeit regelmäßig weiter verfolgt. Insbesondere bin ich in den letzten Jahren darauf bedacht gewesen, beim Unterricht in Seminar und Proseminar durch ein konsequent durchgeführtes System gegenseitiger Beobachtungen möglichst einwandfreies Material für die Beurteilung der mancherlei schwierigen Fragen zu gewinnen, die sich an die verschiedenen Probleme der Sprachmelodie anknüpfen.
Als Resultat dieser sammelnden und ordnenden Tätigkeit hat sich mir, ungesucht, und lediglich aus den beobachtenden Einzeltatsachen heraus, die Überzeugung ergeben, daß die Sprachmelodie auch für die philologische Kritik nur schriftlich überlieferter Texte eine erhebliche Bedeutung besitzt, daß mithin neben die bisher vorwiegend mit Stilllesen arbeitende Augenphilologie, wie man sie kurzerhand nennen kann, eine auf der Erforschung der Eigenheiten und Gesetze der lebendigen, lauten Rede aufgebauten Sprech- und Ohrenphilologie als notwendige und selbständige Ergänzungsdisziplin treten müsse, wenn man die. Grenzen des bisher Erkennbaren mit Aussicht auf bleibenden Erfolg erweitert sehen will.
Auch über dies Problem habe ich, im Zusammenhang mit andern Dingen, bereits einmal, im Herbst 1901, in einem Leipziger Vortrag gehandelt, der vielleicht einigen von Ihnen durch den Abdruck in Ilberg-Richters Jahrbüchern bekannt geworden ist, und auf den ich mich für manche Einzelheiten berufen darf. Wenn ich mir trotz- dem für unsere Versammlung abermals das Wort zu einem Vortrag über dieses Thema erbeten habe, so ist das aus dem Wunsche heraus geschehen, einen Gegenstand, der mir am Herzen liegt, den ich für wichtig halten muß, und der sich ohne mündliche Erläuterung überhaupt nicht gut behandeln läßt, der Aufmerksamkeit eines speziell philologischen Hörerkreises von neuem zu empfehlen. Damit ist zugleich wohl noch eine Sonderentschuldigung für gewisse notwendige Einschränkungen des zu behandelnden Themas gegeben. Auf die psychologischen Grund- lagen der in Rede stehenden Erscheinungen kann ich schon deswegen nicht eingehen, weil sie vorläufig noch völlig dunkel sind. Ebenso schließe ich hier die ästhetische Seite der Frage aus, vor allem die Frage nach den eigentümlichen Wirkungsformen der verschiedenen melodischen Typen in der künstlerisch gestalteten Rede und den Zusammenhang von Form und Inhalt. Ich beschränke mich vielmehr absichtlich auf die Vorführung einer Anzahl nackter Tatsachen, wie sie eben die Beobachtung ergeben hat, und auf den Versuch, an einigen Beispielen zu zeigen, wie auch der philologische Kritiker die Untersuchung der Tonhöhenverhältnisse seiner Quellen sich zu nutze machen kann.
Doch zur Sache selbst.
Alle gesprochene menschliche Rede besitzt zugestandenermaßen einen gewissen rhythmisch-melodischen Charakter. In lebendigem Wechsel bewegt sich speziell die Stimme bald in einer höheren, bald in einer tieferen Lage und steigt oder fällt sie, sei es innerhalb der einzelnen Silbe, sei es von Silbe zu Silbe, von Wort zu Wort, von Satz zu Satz.
Jeder einzelne Satz hat danach auch seine Satzmelodie. In den einzelnen empirischen Satzmelodien aber verschlingen sich zwei verschiedene Elemente. Das eine sind die natürlichen Tonhöhen der isoliert gedachten Wörter. Von solchen Worttonhöhen redet man nun zwar wohl beim Chinesischen u. dgl., aber nicht beim Deutschen und andern europäischen Sprachen: aber sie sind auch da vorhanden und wichtig, denn sie bilden zusammen im Satze eine Art System von Führtönen. Aus diesem System aber gehen die einzelnen empirischen Satzmelodien dadurch hervor, daß das Führtonsystem mit einem ändern System zu einem Ganzen verschmilzt, mit dem, was ich ideelle Satzmelodie nenne. Unter ideeller Satzmelodie aber verstehe ich die melodischen Eigentümlichkeiten, die nicht am einzelnen Wort (oder an der einzelnen Wortform) haften, sondern am ganzen Satze als solchem: also z. B. das Auftreten von Falltönen am Schluß einfacher Aussagesätze im Gegensatz zu den Steigtönen am Ende von Fragesätzen ohne Fragewort, u. dgl. mehr.2
Für die Verständlichkeit der Rede sind nun die Satzmelodien ebenso notwendig und unentbehrlich wie der Satzrhythmus und andere formelle Eigenschaften der Rede. Ohne Rhythmus, Melodie usw. ist überhaupt kein 'Satz' denkbar, sofern man unter 'Satz' nicht eine tote Folge geschriebener Wortbilder auf dem Papier verstehen will, sondern den 'Satz' als das auffaßt, was er ist und sein soll, nämlich als den Träger eines bestimmten Sinnes.
In der gesprochenen Rede werden die Satzmelodien hörbar produziert. Sie haften aber selbstverständlich ebenso an dem nicht gesprochenen, sondern bloß gedachten Satze. Der Unterschied ist nur der, daß die
Melodien im letzteren Palle bloß vorgestellt werden, zugleich mit den Wortreihen, die ihre Träger sind, und aus denen erst durch die — innerlich vollzogene — Addition von Rhythmus, Melodie usw. überhaupt sinnvolle Sätze hervorgehen.
Auch der schweigend arbeitende Schriftsteller produziert daher bei seiner Tätigkeit fortlaufend vorgestellte Melodien, auch wenn er sich dieses Teils seiner Produktion nicht bewußt ist. Beim Niederschreiben seiner Gedanken fallen aber diese Melodien mehr oder weniger vollständig aus: denn unsere Schriftsysteme haben leider kein irgendwie adäquates Ausdrucksmittel für dergleichen Dinge.
Will der Lesende andrerseits einen geschriebenen (oder gedruckten) Satz oder Text verstehen, so muß er den vor seinen Augen erscheinenden Reihen von Wort- bildem aus Eigenem die Sinneselemente erst wieder hinzufügen, die von dem Schreibenden nicht wiedergegeben werden konnten. Dabei ist es gleichgültig, ob der Lesende diese Ergänzung im lauten Sprechen vollzieht, oder durch bloßes Hinzudenken bei stillem Lesen.
Diese Umsetzung der für sich allein betrachtet sinnlosen Textzeichen ins Sinnvolle geschieht zunächst instinktiv, nach dem subjektiven Eindruck, den der Leser, gestützt auf Erinnerungsbilder aus der lebendigen Rede, per analogiam aus der vor ihm liegenden Zeichenreihe gewinnt. Dabei gewährt ihm einerseits das erwähnte System der Führtöne, das ihm die einzelnen Wörter liefern, einen Anhalt, andrerseits das ihm ebenso vertraute System der ideellen Satzmelodien: beides selbstverständlich nur im Zusammenhang mit gewissen (wenn auch wieder nicht klar bewußten) Vorstellungen über zu erwartende oder mögliche Sinnesreihen.
Diese subjektive Ausdeutung der Schriftzeichen durch den Lesenden kann entweder 'richtig’ oder 'falsch’ sein, je nachdem er die von dem Schreiber vorgestellte Melodie trifft oder nicht. Wir müssen also, um Geschriebenes richtig verstehen und würdigen zu können, darauf bedacht sein, Methoden für tunlichste Beseitigung etwaiger Fehlerquellen hei der Deutung ausfindig zu machen.
Als Hauptmittel bietet sich da von selbst die vergleichende Massenuntersuchung dar, die sich auf das Verhalten möglichst verschiedener Leser gegenüber ein und demselben Texte richtet.
Die Massenreaktionen ergeben nun in den meisten einfacheren Fällen ohne weiteres so übereinstimmende Resultate im Typischen der Melodisierung, daß etwaige Zweifel an der 'Richtigkeit' der Deutung des Geschriebenen von selbst hinfällig werden. In schwierigeren Fällen, namentlich da, wo es sich um die Interpretation von künstlerischen oder von Stimmungselementen handelt, treten aber auch große Differenzen auf. Wie soll da entschieden werden? Wer hat Recht?
Meine Beobachtungen, die sich allmählich auf Hunderte von Versuchspersonen erstreckt haben, haben mich da zu dem praktischen Satze geführt, daß in Zweifels- fällen der Instinkt der Masse meist die mehr oder weniger bewußte Auffassung des einzelnen schlägt. Das hängt so zusammen.
Es gibt in der Hauptsache zwei innerlich sehr verschiedene Klassen von Lesern, die aber natürlich im einzelnen durch zahlreiche Mittelstufen miteinander verbunden sein können. Ich will die beiden Extreme kurzerhand als 'Autorenleser' und als 'Selbstleser' bezeichnen. Der Gegensatz deckt sich bis zu einem gewissen Grade mit dem von naivem und bewußtem Leser, aber doch nicht ganz, insofern insbesondere auch der bewußte Leser sich zum Autorenleser erziehen kann.
Der typische Autorenleser ist unter den nicht kunstmäßig geschulten Sprechern am häufigsten vertreten. Er hat meist keine besondere Kunst, und strebt also auch nicht danach, Kunst zu entfalten. Er erwartet nichts von seinem Autor, er läßt sich nur durch ihn treiben. Er reagiert eben, instinktiv und ohne zu wissen warum und wie, sozusagen zwangsweise auf die melodischen Reize, die ihm das Wortgefüge seiner Texte nach dem seiner Sprechweise geläufigen System von Führtönen, Satzkadenzen u. dgl. darbietet. Daher reproduzieren denn auch verschiedene Leser dieser Art ein und denselben Text, den man ihnen vorlegt, durchschnittlich mit auffälliger Gleichartigkeit der Melodisierung. Gewiß kommen auch bei ihnen Differenzen vor, aber sie sind meist leicht zu beseitigen. Denn der einzelne erkennt, eben weil er mit einem natürlichen Instinkt der Reaktion auf die Reize seiner Texte begabt ist, bei der Diskussion streitiger Fälle gewöhnlich ohne besondere Schwierigkeit, daß und wo er sich etwa vergriffen hat.
Ganz anders der typische Selbstleser. Er ist oft ausgesprochener Verstandesmensch, andererseits hat er noch öfter etwas vom Künstler an sich, oder wünscht es zu haben. Darum findet er sich häufiger bei den ausgebildeten Kritikern und Kunstsprechern als im Kreise der naiven Laien. Meist besitzt er eine stärkere Individualität und einen ausgeprägt persönlichen Geschmack (auch bezüglich des Verstandesmäßigen), und diese beiden Elemente sind bei ihm so kräftig entwickelt, daß er sie beim Lesen unwillkürlich in seinen Autor hineinprojiziert, an den er mehr oder weniger bewußt analysierend und mit einem fertigen Kunst- oder Geschmacksprogramm herantritt. Eben darum ist’s auch oft mehr ein Spiel des Zufalls, wenn verschiedene Leser dieser Spezies denselben Text in gleichem Sinne melodisieren, namentlich da, wo es sich um höheren Stil, insbesondere um stimmungsvolle Poesie handelt. Abweichenden Auffassungen gegenüber pflegt der Selbstleser sehr skeptisch zu sein, weil er von seinem Geschmacksstandpunkt nicht lassen mag, und Massenuntersuchungen über die Reaktionen der gemeinen Menge als unkünstlerisch mißbilligt. Sein Haupteinwand gegen die Angabe: „die meisten machen es unwillkürlich so oder so“ pflegt zu lauten: „man (oder „ich“, je nachdem) kann es aber auch anders machen“. Daß er damit die ganze Fragestellung verschiebt, wird er nicht leicht zugeben. Außerdem pflegt er, da er selbst jede Stelle individualistisch zu interpretieren gewöhnt ist, für jede unbewußte Reaktionserscheinung einen besondem Einzelgrund zu verlangen. Er ist auch öfters ungeduldig und möchte nicht gern Zeit auf lange Experimentreihen verschwenden, von denen er 'a priori’ (ich zitiere nach der Erfahrung) zu wissen glaubt, daß sie keine Resultate liefern können.3 Übrigens regt sich der bewußte und kunstvolle Individualismus des habituellen Selbstlesers in voller Stärke meist nur da, wo er weiß, daß der Fragende an bestimmter Stelle eine bestimmte Reaktion erwartet, und wo er also entweder von vornherein besonders auf der Hut ist, oder wo er selbst den Wunsch hat, eine kunstmäßige Leistung darzubieten, in specie zu zeigen, nicht was sein Autor ist, sondern was er aus ihm machen kann. Sonst kann auch der Selbstleser zuzeiten ganz ordnungsgemäß reagieren, denn selbstverständlich schließt auch bewußt kunstmäßiges Sprechen die Möglichkeit „richtiger“ Intuition und Interpretation nicht aus. Aber das eine bleibt doch bestehen, daß der individualistische Selbstleser viel mehr der Gefahr ausgesetzt ist, Persönliches in seinen Autor hineinzutragen, als die große Masse der bloß naiv reagierenden Autorenleser, und eben darum wird bei Untersuchungen über die unwillkürlichen Reizwirkungen, die von den geschriebenen Texten ausgehen, sein Einzelurteil gegenüber der instinktiven und gleichartigen Massenreaktion in der Regel zurücktreten müssen.
Berücksichtigt man die durch das Angeführte gebotenen Kautelen, so kann man allerdings behaupten, es sei möglich, die von dem konzipierenden Autor eines Stückes vorgestellte Melodien bloß aus dessen Text heraus mit einiger Sicherheit zu ermitteln. Die Skepsis wird diesem Satz gegenüber freilich Recht behalten, wenn sie auf Einzelheiten ausgeht, und überall nicht nur melodische Typen, sondern ausgeführte Melodien mit bestimmten Intervallgrößen u. dgl. verlangt. Aber anders, positiv, wird die Antwort lauten dürfen, wenn man die ganze Forderung bescheidener nur auf das Typische und Relative der Melodisierung richtet. Innerhalb dieser Grenzen bürgt wirklich, das ist nicht zu bezweifeln, gleichartige Massenreaktion in der Regel für die Gleichartigkeit der im Text liegenden Reize, und damit auch für die Richtigkeit der gefundenen melodischen Typen. Ja, für den einmal Eingearbeiteten bedarf es schließlich gar nicht mehr vieler Experimente mit Fremden, wenn er sich nur soweit in der Gewalt hat, daß er sich durch die Textworte willenlos treiben zu lassen vermag, ohne Voraussetzungen und bestimmte Erwartungen, auch ohne besondere Leidenschaft oder Pathos, unter Umständen selbst nur murmelnd oder mit halber Stimme andeutend. Er wird dann zwar oft abgeschwächte Melodieformen bekommen, aber das Typische der Melodisierung, vor allem was Stimmlage und charakteristische Folgen von Steig- und Fallschritten anlangt, geht deswegen durchaus nicht verloren: in manchen Fällen tritt es sogar deutlicher hervor als bei stärker markiertem Vortrag, und vor allem sicherer, weil mit der Herabsetzung der Stimmenergie auch ein Nachlassen der geistigen Gesamtspannung verbunden ist, das den Leser reaktionsfähiger macht und ihn so vor dem Hineintragen individueller Einzeleffekte schützen hilft. —
Hier ist nun, ehe ich weitergehe, eine praktische Zwischenbemerkung über eine Tatsache einzuschalten, welche leider die Untersuchung gerade der deutschen Tonhöhenverhältnisse in recht unbequemer Weise kompliziert.
Es gibt nämlich, wie ich schon verschiedentlich an anderer Stelle hervorgehoben habe, im Gesamtgebiet der deutschen Sprache nicht ein einheitliches Intonationssystem, sondern zwei solcher Systeme stehen einander schroff gegenüber,4 ganz abgesehen von den Partialsystemen der einzelnen kleineren Landschaften, die sich doch immer wieder auf die beiden Hauptsysteme zurückführen lassen. Diese Systeme sind, grob ausgedrückt, das niederdeutsche und das hochdeutsche. Die Bühnenintonation geht im ganzen mit dem niederdeutschen System. Der Unterschied der beiden Systeme aber besteht darin, daß — von bestimmten, für unsere Zwecke ausschaltbaren Ausnahmen abgesehen — alles, was beim Niederdeutschen hoch liegt, beim Hochdeutschen als tief erscheint, und daß, wo der Niederdeutsche von Silbe zu Silbe, von Wort zu Wort usw. mit der Stimme steigt, der Hochdeutsche einen Fallschritt macht, und umgekehrt. Die Kurven für niederdeutsche und hochdeutsche Intonationen und Satzmelodien verhalten sich also im allgemeinen wie zwei Spiegelbilder zueinander. Ich muß also, da ich selbst niederdeutsch intoniere, meine hochdeutschen Hörer bitten, eventuell meine Angaben über Hoch und Niedrig umzukehren, wenn sie ihnen nicht doch schon ohne dies, infolge ihrer Gewöhnung an die bühnenmäßige Intonation, von vornherein als einleuchtend erscheinen. Daß auch das letztere möglich ist, hat beiläufig darin seinen Grund, daß der nivellierende Einfluß der Verkehrs- und Bühnensprache, zumal bei den Gebildeten, den alten Unterschied vielfach verwischt hat. Viele Individuen haben wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens ihr Intonationssystem umgelegt (ich selbst glaube dazu zu gehören). Andere, namentlich Mitteldeutsche, schwanken oft regellos zwischen den beiden Systemen. Wer in dieser Lage ist und doch sein ursprüngliches Tonhöhengefühl stärken möchte, wird gut tun, bei seinen Proben zu einer kräftig dialektisch gefärbten Aussprache seine Zuflucht zu nehmen: mit dieser pflegt auch die alte Intonation wieder rein hervorzutreten.
Doch nun zur Sache selbst wieder zurück.
Die freie Rede, wie sie sich etwa im kunstlosen Gespräch abspielt, dürfte in den meisten Fällen dem nicht schärfer analysierenden Beobachter ein Bild vollkommener Regellosigkeit darbieten, und so wird man geneigt sein, auch der schriftlich fixierten Prosarede keinen besonders hohen Grad von melodischer Gebundenheit zuzuerkennen. So habe auch ich noch in meinem Leipziger Vortrag von 1901 [s. oben S. 60] als selbstverständlich angenommen, daß für die Prosa Rhythmus und Melodie im Prinzip von
Fall zu Fall frei beweglich sei. Daß das nicht so ist, lernte ich ein Jahr später durch eine Erfahrung persönlichster Natur, die mich selbst seinerzeit nicht wenig verblüffte. Als ich nämlich nach dem nächsten Leipziger Rektoratswechsel die Fachrede meines Amtsnachfolgers gedruckt nachlas, bei deren Anhören mir gar nichts Besonderes aufgefallen war, empfand ich dauernd einen zunächst unfaßbaren Widerstand, der mich am raschen und behaglichen Erfassen des Gelesenen hinderte. Rein zufällig bemerkte ich dann, daß jeder Satz der gelesenen Rede für mich mit einem ausgesprochenen melodischen Steigschritt begann. Da ich etwas Derartiges in einem Prosatext, zumal wissenschaftlichen Inhalts, nicht erwartet hatte, wurde ich stutzig und fragte mich, ob etwa darin jenes Hemmnis gelegen haben könne. Zum Vergleich schlug ich deshalb meinen in demselben Programm enthaltenen Geschäftsbericht über das abgelaufene Rektoratsjahr nach, und ich war nicht wenig erstaunt, zu finden, daß ich selbst ebenso konsequent jeden Satz mit einem Fallschritt hatte beginnen lassen, ohne mir dessen bei der Abfassung des Berichtes im geringsten bewußt geworden zu sein, trotz all der Arbeiten der vergangenen Jahre auf dem Gebiete des Sprachmelodischen. Nur eine Gruppe von Ausnahmen bestätigte die Regel: einige von fremder Hand verfaßte Nekrologe, die herkömmliche Eidesformel und gewisse weitere formelhafte Sätze, die nach altem Brauch alljährlich bei der Übergabe der Insignien in gleichem Wortlaut wiederholt zu werden pflegten und die daher auch von mir wörtlich aus dem alten Formular übernommen waren, zeigten abweichende Satzeingänge. Damit war denn das scheinbare Rätsel gelöst, d. h. der empfundene innere Widerstand erklärte sich nun einfach genug als unbewußte Reaktion gegen die der meinigen direkt konträre Melodieführung des Gelesenen.
Was sich mir hier in einem besonderen Falle geradezu aufgedrängt hatte, habe ich seitdem immer und immer wieder bestätigt gefunden. Man kann in der Tat leicht beobachten, wie auch in der (geschriebenen) Prosarede gewisse melodische Elemente (z. B. die Stimmlage ganzer Sätze oder einzelner Satzteile, typische Steig- oder Fallschritte an bestimmten Stellen) in überwiegender Häufigkeit wiederkehren, ja unter Umständen mit absoluter Konstanz, auch wo es sich gar nicht um besondere schriftstellerische Kunstentfaltung handelt. Es erscheint mir danach sicher, daß eben diese typische Melodieführung ein höchst wichtiges Element dessen ist, was wir Stil nennen, und daß der spezifische Stil eines Autors oder eines Werkes oft geradezu in erster Linie durch die Art seiner Melodieführung charakterisiert oder bestimmt wird, mag es sich dabei um Poesie oder um Prosa handeln.
Am wenigsten sollte man, wie gesagt, eine solche typische Konstanz des Melodischen in der Prosa erwarten. Und doch herrscht gerade da bei zahllosen Autoren eine so weitgehende und hochgradige Gebundenheit, wie man sie zumal in der modernen Poesie nicht oft finden möchte.
Man braucht zur Erhärtung dieses Satzes nur ein paar beliebige Stichproben aus verschiedenen Autoren zu analysieren.5 Ich greife zu dem Zweck ein paar Rezensionen aus einer Dezembernummer der deutschen Literaturzeitung [1903, Nr. 49 vom 5. Dez.] heraus, die mir zufällig in die Hände gekommen ist.
Da beginnt z. B. der erste Rezensent jeden Satz [bzw. jedes größere und melodisch selbständige Satzstück] in etwas tieferer Stimmlage; dann geht er eine Weile in die Höhe, und wechselt dann in einer dritten Satzstrecke regelmäßig mit Hoch- und Tiefstücken ab. Besonders ausgeprägte Intervalle sind innerhalb der Einzelstrecke nicht vorhanden. Ebenso fehlen stärkere Schlußkadenzen.
Probe: Zur Abwehr, | so führt sich Trübners Schrift auf dem Titelblatt ein, || zur Abwehr gegen Büchers bekannten Angriff. Sie ist, | wie ich gern gleich hervorhebe, || sachlich und friedlich gehalten .... Denn darüber | wird im Grunde keine Meinungsverschiedenheit herrschen, || daß der Verlagshandel | [neues Satzstück] und ebenso | auch der Sortimentshandel || wenigstens zurzeit in Deutschland schlechthin unentbehrlich ist. Wenn behauptet | worden ist, daß Bücher den Sortimentshandel überhaupt zertrümmern wolle, || so ist das als ein nicht unvermeidbares Mißverständnis zu bezeichnen.
Verfasser: Friedrich Paulsen, Berlin.
Bei einem zweiten finden wir: höheren Einsatz, dann Herabsinken auf ein ziemlich ebenmäßiges Niveau, das mit einer starken hoch-tiefen Kadenz abschließt:
Probe: Dieses Buch | enthält eine überaus fleißige Untersuchung eines für die Beurteilung des katholischen praktischen Christentums | wichtigen || Begriffes. Der Verf. | geht wesentlich in den Spuren von A. Ritschls postumem Werk: | fides || implicita. Auf das sorg | fältigste werden Ritschls Aufstellungen nachgeprüft und an nicht wenigen Stellen | ergänzt und || verbessert.
Verfasser: Reinhold Seeberg, Berlin.
Dritter Fall: Hoher Einsatz, dann lebendiger Wechsel von Höher und Tiefer, sozusagen von Iktus zu Iktus. Kräftiger Tiefschluß.
Probe: Es ist an sich eine widerspruchsvolle Aufgabe, ein Buch über die Philosophie eines Mannes zu schreiben, wenn das Endresultat aller darüber angestellten Betrachtungen dahin lautet, daß er nichts weniger als ein Philosoph war, immer nur oberflächliche und fragmentarische Bekanntschaft mit der gleichzeitigen Philosophie machte und auch nur ein rein eklektisches Verhalten gegenüber der ganzen Geschichte der Philosophie einhielt. Das aber ist die Quintessenz des vorliegenden Werkes, dessen einzelne Artikel schon 1894 in der protestantischen «Revue chrétienne» erschienen waren und so in der ersten Auflage vereinigt sind. Daher heißt es auch jetzt noch gleich S. 1, Renans Tod sei «depuis de plus de deux ans» erfolgt. Fast ebenso gut wie «la philosophie», der das 2. Kapitel gewidmet ist, könnte das Ganze auch «la morale» nach dem Titel des 4., oder «la religion» nach dem 6. Kap. benannt sein. —Verfasser: Heinrich Holtzmann, Heidelberg.
Vierter Fall: Alle Intervalle auf ein Minimum reduziert, also überhaupt keine ausgeprägte Melodie:
Probe: Bei der Beurteilung von Meyers Übersetzungen von Ksemendras Samayamatrka und Damodaraguptas Kuttanimata muß man beachten, daß M. nicht bloß Philolog, sondern auch Dichter ist. Gleichzeitig mit diesen Übersetzungen sind von ihm in demselben Verlage zwei Bände Gedichte erschienen, deren einer den Titel trägt : ... Im Vorwort zur ersten Sammlung hat M. seinem Vater ein Denkmal gesetzt, das gleich ehrenvoll für diesen wie für M. selbst ist und uns einen Blick in seinen Werdegang tun läßt. Geboren in Amerika als Sohn eines deutschen Bauern, der den Urwald in mühsamem Ringen in fruchtbares Ackerland verwandelte, aber stets auch für geistige Beschäftigung Zeit zu erübrigen suchte, hat M. ursprünglich seinem Vater als Landmann zur Seite gestanden. — Verfasser: Richard Pischel, Berlin.
Einen abermals neuen Typus mag ein fünfter Fall veranschaulichen. Während die bisher zitierten Autoren alle Sätze gleichmäßig in éiner Stimmlage bildeten, wechseln hier je ein tiefer und ein höher liegender Satz miteinander ab:
Probe: a) Da es ein in die Vergangenheit zurückgreifendes Buch über französischen Versbau zum Gebrauche für Engländer bisher nicht gegeben hat, so wird das des Herrn Kastner ohne Zweifel manchen willkommen sein, b) Daß viel andere als lang bekannte Tatsachen darin zur Sprache gebracht seien, scheint mir nicht, a) Aber es ist das an vielen Stellen über die auch hier behandelten Dinge Gesagte mit Fleiß und Verständnis und in klarer Fassung zusammengestellt, vielfach auch durch selbstgesammelte Beispiele erläutert und veranschaulicht. b) Darf man einiges hier Besprochene als nicht recht hergehörig bezeichnen, wie z. B. die Lehre von den Inversionen, die Auseinandersetzungen über Akrostichon und bouts rimés, anderes wieder als unnütz, wie etwa die lange und doch natürlich unvollständige Aufzählung heute vorkommender Strophenformen, so könnte man an anderen Stellen etwas eingehendere Betrachtung wünschen.
Verfasser: Adolf Tobler, Berlin.
Diese wenigen, nur grob umrissenen Beispiele mögen für die Prosa genügen.
In der Poesie andrerseits herrscht natürlich ebensowenig an sich ein zwingendes Muß; im Prinzip kann auch der Dichter zwischen Freiheit und Gebundenheit wählen wie er will und wie er es im einzelnen als angemessen empfindet. Aber auch im Dichter offenbart sich doch normalerweise der Trieb zu melodischer Regelung; nur erstreckt sich die Regelung in bestimmtem Sinne da sehr oft nur auf das einzelne Gedicht, oder auf die Gedichte einer bestimmten Periode u. dgl., während der Prosaiker viel öfter ein und dasselbe System durch alle seine Arbeiten, oder doch durch größere Massen, hindurchführt.
Gerade die Gebundenheit des Melodischen in der Dichterrede ist aber eben das Element, dessen Bedeutsamkeit für die Kritik ich hervorheben und kurz erläutern möchte. Ich glaube hier folgende These aufstellen zu können:
“Störungen des Melodischen weisen überall da, wo sonst in greifbarer Weise melodische Gebundenheit herrscht und nicht etwa besondere Gegengründe ein anderes Urteil erheischen, mit Sicherheit auf das Eindringen fremder Elemente bzw. Störungen des ursprünglichen Wortlauts oder der ursprünglichen Form hin.“
Über die Richtigkeit und die Tragweite einer solchen These kann natürlich nur die praktische Probe entscheiden. Und die Zahl der hier verwendbaren Beispiele ist Legion.
Ganz einwandfrei dürften vor allem die Fälle sein, wo ein Dichtwerk nachweislich in ursprünglicher und in sekundär veränderter Form vorliegt, von denen die erstere zugleich melodische Gebundenheit zeigt, während der sekundäre Text Störungen aufweist.
Als besonders wertvoll und instruktiv können uns hier die Doppelgestalten mancher Goethischer Jugenddichtungen (einschließlich des besonders lehrreichen Faust) deshalb gelten, weil gerade der junge Goethe, von der Straßburger Zeit ab, in der Kunst intuitiver melodischer Charakterisierung, und zwar stetiger Charakterisierung, als Meister dasteht. Goethe ist dieser Stufe spezieller Kunstvollendung auch in späteren Perioden seines Schaffens wieder nahe gekommen. Aber zwischenhinein fallen Zeiten, wo seine Dichtung melodisch weniger voll erklingt, oder wo doch wenigstens sein Ohr für die Reinheit einst selbstgeschaffener Melodieformen weniger empfindlich geworden war, weil er die die ursprüngliche Formgebung beherrschenden, melodisch einheitlichen Suggestivstimmungen der Jugendzeit nicht wieder in sich wachzurufen vermochte.
Als Beleg hierfür greife ich etwa den König von Thule heraus. Hier sind in allen Zeilen, die im alten und neuen Text übereinstimmen, die Tonhöhen der Hebungen nach dem Kontrastprinzip so geordnet, daß auf jede höher liegende Hebung eine tiefer liegende folgt, und umgekehrt. Da nun die erste Zeile der Strophe (nach niederdeutscher Intonation gerechnet, die natürlich für Goethe selbst in ihr Gegenteil umzusetzen wäre) mit einer tieferen Hebung einsetzt, so zeigt die erste Zeile (a) die Folge tief-hoch-tief, die zweite (b) die umgekehrte Folge hoch-tief-hoch,1 und dieses Spiel wiederholt sich jedesmal in dem zweiten Zeilenpaar jeder Strophe.6 Für jedes Zeilenpaar gilt also das Schema (a) .·. | (b) ·.· ||. So z.B. in der Schlußstrophe:
Er sa.h ihn stü·rzen, tri.nken | Und si·nken tie.f ins Mee·r: ||
Die Au.gen tä·ten ihm si.nken, | Trank nie· einen Tro.pfen me·hr. ||
Aber wo der uns geläufige Text auf Überarbeitung beruht, ist dies melodische Schema entweder direkt gestört, oder bis zur Undeutlichkeit verdeckt. Die erste Strophe lautete einst:
Es wa.r ein Kö·nig in Thu.le, | Einen go·ldnen Be.cher er he·tt || Empfa.ngen von sei·ner Buh.le | Auf i·hrem To.desbe·tt. ||
Jetzt lesen wir:
a) Es wa.r ein Kö·nig in Thu.le, |
(übereinstimmend, also korrekt Schema a)
b) Gar treu. bis a·n das Gra˙b ||
(die drei Töne bilden eine schwach ansteigende Reihe . · ˙ ),
a) Dem ste.rbend sei·ne Bu˙hle |
b) Einen gol.dnen Be·cher ga.b ||
(hier in a wieder glatt ansteigende Tonreihe mit sehr auffälligem Hochschluß auf Buhle, in b zwar wieder Konträrabstufung, aber mit der Folge . · ., die vielmehr nach a hinüber gehört).
Ähnlich ist es auch der zweiten und dritten Strophe bei der späteren Umbildung ergangen. Das übrige ist unverändert geblieben.
Wem die Zahlenverhältnisse eines so kurzen Gedichtes nicht genügend beweiskräftig erscheinen, kann sich zur Ergänzung mit Vorteil etwa an den Faust halten. Hier sind, wie ich bereits in dem Leipziger Vortrag ausgeführt habe [s. oben S. 69] im Urfaust die Reden Fausts und Valentins dadurch charakterisiert, daß jede Zeile mit einem 'Tiefschluß' endet, d. h. daß die letzte Hebung tiefer liegt als die vorletzte; die Verse des übrigen haben ebenso konsequent „Hochschluß“ oder „Niveauschluß“: nur Mephisto wechselt mit beiden Arten von Schlüssen in markantem Kontrast ab.
Das ist nun im späteren Text auch so, soweit der alte Wortlaut intakt geblieben ist. In allem zum Bestand des Urfaust neu Hinzugekommenen ist dagegen von dieser Art der Charakteristik nichts mehr zu finden. Außerdem sind aber auch in dem sonst übernommenen alten Text die typischen Versschlüsse fast überall da gestört worden, wo eine Änderung sich auf das Reimwort erstreckt. Gleich bei den ersten Worten Fausts ist das deutlich. Statt des alten
Hab nun ach die Phi·losophe.y,
Medizin und Ju·ristere.y,
Und leider auch die The·ologi.e
Durchaus studiert mit hei·ßer Mü.h
lesen wir jetzt
Habe nun ach Philo.sophi·e,
Juristerei und Me.dizi·n
Und leider auch Theo.logi·e
Durchaus studiert mit he.ißem Bemü·hn
mit vier Hochschlüssen, die scharf absetzen gegen das folgende alte
Da steh ich nun, ich a·rmer To.r,
Und bin so klug als wi·e zuvo.r;
dann folgt wieder mit unursprünglichem Hochschluß
Heiße Magister, heiße Do.ktor ga·r
statt des früheren
Heiße Doktor und Profe·ssor ga.r
usw.
Ähnliches gilt auch von den zahlreichen Korrekturen, welche das Versinnere betroffen haben. Ja, es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß selbst der Anfänger im Beobachten dieser melodischen Dinge schon nach nur geringer Übung meist imstande sein wird, bei der Lektüre des gewöhnlichen Fausttextes ohne Einblick in den Ur- faust mit ziemlicher Sicherheit anzugeben, wo der Urfaust eine Variante haben muß — und wo er sie denn tatsächlich auch hat.
Aus Rücksicht auf die mir zu Gebote stehende Zeit muß ich mir versagen, hier weiteres neuhochdeutsches Material vorzuführen, so lehrreich auch gerade solche modernen Parallelen für die Beurteilung des uns doch um eine Stufe ferner stehenden deutschen Mittelalters sind und sein müssen. Eine Art von Ersatz für diese Lücke der Beweisführung bietet glücklicherweise ein Umstand, der unsere mittelalterliche Dichtung dem Beobachter noch leichter zugänglich (d. h. melodisch erfaßbar) macht, als viele Werke der neueren Poesie. Es ist der Umstand, daß — um ein Hauptergebnis meiner Untersuchungen vorauszunehmen — die stimmlich-melodische Gebundenheit bei den mittelalterlichen Dichtem viel größer ist als bei den modernen. Es ist eine seltene Ausnahme, wenn etwa ein Dichter des deutschen Mittelalters über mehr als éine Art typischer Melodisierung frei, oder gar bewußt, verfügt. Was uns aber vielleicht am meisten befremdet, ist die oft geradezu rätselhafte Konstanz der allgemeinen Stimmlage. Uns mag es zwar höchst unnatürlich und zweckwidrig, ja als unmöglich Vorkommen, daß der einzelne Dichter (auch solche die Zehn- und Hunderttausende von Versen hinterlassen haben) in all seinen Werken, groß oder klein, episch oder lyrisch, und unbekümmert um Inhalt und Stimmung des Ganzen oder seiner Teile, nur in éiner Tonlage gedichtet haben soll. Auf Grund zahlreicher Reaktionsproben kann aber nicht bezweifelt werden, daß auch das doch durchaus die gewöhnliche Regel ist, und daß Ausnahmen davon nur selten begegnen.
Natürlich soll damit nicht gesagt sein, daß der mittelalterliche Dichter überhaupt keine Modulation besessen habe. Es soll nur heißen: Jeder moduliert immer von einem persönlichen, einheitlichen Niveau aus, das innerhalb des natürlichen Gesamtumfangs seiner Stimme (wie der menschlichen Stimme überhaupt) eine bestimmte Lage hat. Er verkehrt sozusagen nur in einer Etage des menschlichen Stimmgebäudes, und geht in dieser wohl treppauf und treppab, aber er versteigt sich nicht in andere, höhere oder tiefere Geschosse. Alle seine Intervalle liegen innerhalb gewisser Grenzen um einen persönlichen Durchschnittston herum, der durch die Vornahme gewisser technischer Hilfsmanipulationen von dem Geübten unschwer festgestellt werden kann:7 nur muß man natürlich auch hier wieder mit der dialektischen Umlegbarkeit alles Stimmlichen rechnen, also in Betracht ziehen, daß wenn z. B. Hartmann von Aue in allen seinen echten Werken dem niederdeutsch intonierenden Leser als ausgesprochener Tiefstimmer erscheint, während ihm Wolfram von Eschenbach auf mittlerer, Gottfried von Straßburg auf hoher Tonstufe liegt, bei dem hochdeutschen Leser genau die umgekehrte Einschätzung zu erwarten ist und in der Regel auch wirklich eintritt.
Die Gebundenheit des Stimmlichen und Melodischen ist nun in der Dichtung des deutschen Mittelalters so groß, daß sie geradezu als ein kritisches Hilfsmittel ersten Ranges bezeichnet werden darf. Gestattet sie doch z. B. selbst so subtile Fragen mit Sicherheit zu entscheiden, ob etwa an einer Stelle ein unbetontes e im Verse mitzusprechen oder zu beseitigen ist. Doch möchte ich von solchen Finessen hier absehen und mich auf die Vorführung einiger gröberer Beispiele beschränken.
Jenen Doppelgestalten Goethischer Dichtungen sind in gewissem Sinne die Doppelgestalten zu vergleichen, in
denen viele Stücke der mittelhochdeutschen Dichtung uns vorliegen: einmal in der handschriftlichen Überlieferung, sodann, zugestutzt nach den Regeln einer schematisierenden Metrik, in manchen der sog. kritischen Ausgaben moderner Herausgeber. Dieser Fall findet sich namentlich oft bei den Liedern der ältesten mittelhochdeutschen Lyriker, die in Lachmanns und Haupts Sammlung „Des Minnesangs Frühling“ vereinigt und dort mehr oder weniger nach den metrischen Regeln der klassischen Zeit behandelt worden sind, obwohl ihre Technik in nicht unwesentlichen Punkten noch nicht den Stand der klassischen Periode erreicht hatte.
Eines der ohrenfälligsten Beispiele solch kritischer Zerstörung eines gut überlieferten Textes bietet das sog. Tagelied Dietmars von Aist, das ich bereits anderwärts analysiert habe und daher hier nicht noch einmal durchgehe [s. oben S. 73 f.]. Dafür ein anderes Beispiel.
Unter den Liedern desselben Dietmar ist ein altes anonymes Falkenlied überliefert. Es lautet in der handschriftlichen Form (abgesehen von Orthographischem):
E·z stu.ont ein frouwe allei.ne
u·nd wa.rte über heide,
u·nd wa.rte ir
so· gesa.ch sie valken fli.egen.
so· wo.l dir, valke, daz du bi.st!
du· fli.ugest swar dir liep i.st:
du· e·rki.usest dir in dem wa.lde
einen bo.um der dir geva.lle.
a.lsô hân ouch ich getâ.n.
i·ch e·rkô.s mir selbe einen ma.n:
de·n e·rwe.lten mîniu o.ugen.
da·z nî.dent schoene fro.uwen.
[owê wan lânt si mir mîn liep?
jo’ngerte ich ir deheiner trûtes niet.]
Das Lied ist in dieser Gestalt, von den beiden höchstwahrscheinlich sekundären Schlußzeilen abgesehen, einheitlich tiefstimmig, und die Auftakte liegen stets höher als die erste Hebung. Alle Zeilen schließen tief.
Aber der Text ist mit vier zweisilbigen Auftakten und Senkungen behaftet, die Lachmanns Auffassung von der mhd. Metrik zuwiderliefen. Diese sind also in Minnesangs Frühling beseitigt (zwei davon übrigens auf Kosten des Sinnes und Sprachgebrauches, die dritte auf Kosten einer syntaktischen Regel, die damals nicht genügend bekannt war). Lachmann schreibt
du.͡ erki·usest [dir] in dem walde
ei.͡n[e]n bo·um der dir gevalle.
ich erkôs mir selbe [einen] man,
de.͡n [er]we·lten mîniu ougen.
Er schafft dadurch vier Zeilen, die ausgesprochen höher liegen als der überlieferte Text. Er beseitigt ferner die Tiefschlüsse, und legt die Fallschritte von Auftakt zu erster Hebung in Steigschritte um, und so bringt er wieder eine, doch sicherlich unzulässige, Stimmunruhe in das Lied hinein.
Ebenso nützlich und wichtig ist die Stimmprobe, wo Überlieferung gegen Überlieferung steht. Auch dafür zunächst nur ein paar beliebige Beispiele.
Die Strophen des sog. jüngeren Spervogel zeigen, soweit sie gut und sicher überliefert sind, gleichmäßig mitteltiefe Stimmlage. Die zweite dieser Strophen setzt aber nach dem Text von Minnesangs Frühling unverkennbar höher ein, und sinkt erst im Laufe der ersten Zeile auf das Niveau des übrigen ab:
Unmaere hunde sol man schüpfen zuo dem bern,
und rôten habech zem reiger werfen, tar ers gern,
und eltiu ros zer stuote slahen,
mit linden wazzem hende twahen,
usw. Damit wird die in Minnesangs Frühling gewählte Lesart sofort stark verdächtig. Sieht man näher zu, so ergibt sich, daß die Lesart von J Unmaere hunde sol man schüpfen von Lachmann vermutlich als der gewähltere Ausdruck bevorzugt worden ist, gegenüber dem scheinbar blassen Man sol die jungen hunde lâzen von AC. Auch dachte Lachmann (wie gewiß der Urheber der Lesart von J) vielleicht an ein Sprichwort wie das bei Wolfram von Eschenbach überlieferte man sol hunde umb ebers houbet geben. Aber die Zusammenstellung der Hunde mit dem roten, d. h. jungen Habicht (und hernach die Kon- trastierung mit den eltiu ros) weist doch eher darauf hin, daß der Dichter der Meinung war, man solle die Jagdtiere jung an ihre Arbeit gewöhnen (und zur Jagd verwenden), da ausgediente alte Roß aber zur Herde schicken. Und daß das richtig ist, zeigt die Stimmprobe. Denn liest man mit AC
Man sol die jungen hunde lâzen zuo dem bern,
und rôten habech zem reiger werfen, tar ers gern,
so verschwindet sofort die stimmliche Anomalie.
Die vierte Strophe zeigt in Z.2 falsche (zu hohe) Tonlage, und in Z.3 einen sehr auffälligen Tonsprung von dem ersten Wort auf das zweite:
Er zimt wol helden daz si frô nâch leide sîn.
kein ungelücke wart sô grôz, da enwaere bî
ein heil: des sul[n] wir uns versehen.
Zeile 2 verdankt diese falsche Stimmlage der Tilgung eines nie, das Lachmann gestrichen hat, um eine zweisilbige Senkung zu beseitigen. Aber lesen wir nun auch mit Wiedereinsetzung dieses nie
Ez zimt wol helden daz si frô nâch leide sîn.
kein ungelücke wart nie sô grôz, da’nwaere bî
ein heil: des sul wir uns versehen,
so bleibt immer noch der unmotivierte Stimmsprung in der dritten Zeile. Auch er verschwindet indessen, wenn man die hier zweifellos prägnantere Lesart von C (gegen A) einsetzt:
Kein ungelücke wart nie sô grôz, da’nwaere bî
sîn heil: des sul wir uns versehen.
In das Gebiet der höheren Kritik hinüber führt uns sodann die dritte Spervogelstrophe. Die vorhin besprochene zweite Strophe schließt mit den Worten (man soll)
mit rehtem herzen minnen got,
und al die werlt wol êren,
und neme ze wîsem manne rât
und volge ouch sîner lêre.
Daran knüpft in Strophe 3 ein Kollege des Dichters so an :
Swer suochet rât und volget des,
der habe danc, aise mîn geselle Sper
und solde er leben tûsent jâr,
sîn êre stîgent, daz ist wâr,
usw. Der Wechsel des Dichters verrät sich sofort auch durch einen Wechsel der Tonlage, die in der dritten Strophe höher ist als in der vorhergehenden. Mit Strophe 4
Ez zimt wol helden, daz si frô nâch leide sîn
usw. kommt dann der wirkliche Spervogel wieder zu Worte, mit seiner normalen Stimmlage. —
Lassen Sie mich hieran noch einige Bemerkungen zum Nibelungenlied anknüpfen, dessen heißumstrittene Entstehungsgeschichte ja vielleicht besonderes Interesse darbietet. Täusche ich mich nicht, so wird man auch hier durch gewissenhafte Beiziehung der stimmlichen Kriterien einen großen Teil der schwebenden Fragen einem beruhigenden Abschluß näher bringen können.
Wir sind darüber wohl jetzt alle einig, daß der C*- Text eine stark ändernde Überarbeitung darstellt. Dies Urteil bestätigt sich auch dadurch, daß nicht nur die eigenen Strophen von C* einen besonderen Typus (bzw. besondere Typen) haben, sondern auch die nur teilweise von B* abweichenden Strophen in sich melodisch schwanken, während der entsprechende B*-Text melodisch glatte Gebilde aufweist.
Über das Verhältnis von A und B* ist dagegen auch nach Braunes eindringlicher Untersuchung noch keine volle Einigung erzielt. Die Stimmprobe entscheidet, mit Braune, wie gegen C*, so auch gegen A: denn wo A mit B* zusammengeht, wo also auf alle Fälle der für uns erreichbare älteste Text vorliegt, herrscht innerhalb der Einzelstrophe (soweit diese nicht etwa uneinheitlicher Herkunft ist) wieder melodische Konsequenz, und da wo A von B* abweicht, tritt in A wieder eine Unstetigkeit des Melodischen charakteristisch hervor: bei B* aber finden wir in allen solchen Fällen dieselbe Gleichmäßigkeit wie im gemeinsamen Text von AB*.
Ein paar beliebig herausgegriffene Beispiele (deren Varianten absichtlich keinen besondern Sinneswert haben) mögen das veranschaulichen.
Mit ein paar (durch untergesetzte Punkte markierten) kleinen Korrekturen der Sprechformen lesen wir in B* z. B.
326 | Ez was ein küneginne gesezzen über sê: ir gelîche enheine man wesse ninder mê. diu was unmâzen schoene, vil michel was ir kraft, si schôz mit snellen degenen umbe minne den schaft. |
327 | Den stein den warf si verre, dar nâch si wîten spranc. swer ir minne gerte, der muose âne wanc driu spil an gewinnen der frouwen wol geboren: gebrast im an dem einen, er hete daz houbet sîn verloren. |
Beide Strophen erfordern, wie mir scheint, gleichmäßig einen lebhaften Staccatovortrag, mit geradezu etwas stoßendem Rhythmus; namentlich in der Zäsur tritt ein scharfer Bruch zwischen den beiden Hälften der Langzeilen ein: man setzt ab, als ob der Satz zu Ende wäre, auch Wo gar kein syntaktischer Einschnitt ist. Die Tonlage ist nach dem norddeutschen Intonationssystem mäßig hoch. Die Auftakte liegen ein wenig tiefer als die zugehörigen ersten Hebungen, und die drei Hebungen der ersten 7 Halbzeilen bilden jedesmal eine zwar nur sehr schwach, aber doch merklich, in gerader Linie aufsteigende Tonreihe (also . · ˙); nur die achte Halbzeile biegt statt dessen nach unten um, etwa in der Form . · ˙ ·, und jedenfalls nicht so, daß eine Zickzackbewegung nach dem Schema . · . · oder · . · . möglich wäre.
In Str. 326 stimmt C* zu B*, in Str. 327 dagegen bietet C* den Text
Den stein, den warf si verre, dar nâch si wîten spranc,
swer an si wenden wolde sînen gedanc,
driu spil muos er an behaben der frouwen wol gebom:
gebrast im an dem einen, er bet daz houbet sîn verlorn.
Hier verliert sich zwangsweise beim Lesen an den (im Text gesperrten) von B* abweichenden Stellen der Staccatocharakter des Vortrags, um hernach mit 3b wieder einzusetzen, und die Melodie ist an der differierenden Stelle umgebildet zu . · . | · . · || · . · ˙ | statt der zu erwartenden Folge . · ˙ | . · ˙ || . · ˙ |.
Ganz ähnlich fällt aber auch A aus dem melodischen Rahmen heraus, wo sein Text von B* abweicht. So in
327 | Den stein den warf si verre, dar nâch si wîten spranc. swer ir minne gerte, der muose âne wanc driu spil an gewinnen der frouwen wol geboren: gebrast im an dem einen, er hete daz houbet sîn verloren. |
Auch hier kann ich an den differierenden Stellen das Staccato nicht einhalten, und wiederum zeigen diese gebrochene Tonfolgen (. · . und . · . · oder umgekehrt) statt der glatten Reihen des gemeinsamen Textes; außerdem tritt mindestens die vierte Langzeile aus dem Tonniveau des gemeinsamen Textes heraus. Das gilt denn auch von 326,3a si was unmâzen schœne A gegenüber diu was unmâzen schoene B*C*, und ebenso von 326,2, auch wenn man mit Lachmann den metrisch unvollständigen Text von A zu <ninder> ir gelîche | was deheiniu mê || ergänzt.
Die nächstfolgende Strophe 328 erscheint bei Bartsch in dieser Gestalt;
Des het diu juncfrouwe unmâzen vil getân.
daz gevriesch bî dem Rîne ein ritter wol getân,
der wande sîne sinne an daz scœne wîp:
darumbe muosen helede sît verliesen den lîp.
Man wird da leicht heraushören, daß in 2a die Worte daz gevriesch (für die niederdeutsche Intonation) viel zu hoch liegen, daß speziell die Silbe vriesch deutlich über die Zone hinausragt, innerhalb deren sich sonst die Melodie der Strophe bewegt. Das fällt diesmal aber nicht dem Text B* zur Last, sondern nur dem Herausgeber Bartsch (der dabei einer alten Anregung von Lachmann folgte); denn gevriesch steht nur in Ca. Dagegen haben die Gruppen Db* + B* + Id das farblosere (ge)hôrte. Dies gehôrte fordert also schon der Stammbaum der Handschriften für den Text, mindestens für den von B*. Daz gehôrte bî dem Rîne schließt sich denn auch wirklich dem folgenden stimmlich in jeder Beziehung korrekt an. Hinwiederum ist sicher auch das vernam von A nicht ursprünglich, denn daz vernam bî dem Rîne zeigt denselben melodischen 'Fehler', wie die Lesart von Ca.
Das hier Vorgeführte wiederholt sich mutatis mutandis an zahllosen andern Stellen, und fast immer ist dabei, soweit ich kontrolliert habe, A auf Seite des melodisch Anomalen zu finden und zeigt nur selten eine melodisch indifferente Abweichung. Auch von diesem Gesichtspunkt aus erweist sich also der Redaktor von A als Änderer, nicht als Bewahrer einer ursprünglicheren Textform.
Nicht minder werfen die Stimmkriterien auch für die Frage 'nach der Entstehungsgeschichte unserer Nibelungentexte im weiteren Sinne einiges ab. Aber allerdings wachsen da die Schwierigkeiten der Untersuchung in solchem Maße an, daß vorläufig noch größte Zurückhaltung geboten erscheint.8
Die Hauptfrage ist diese: Lachmanns Liedertheorie in ihrer strengen Fassung dürfte jetzt im wesentlichen aufgegeben sein. Ist aber darum das, was wir als unsere älteste direkt erreichbare Grundform des Textes bezeichnen müssen, also die Textform B* (oder für den, der trotz allem noch an einer Autorität von A festhalten will, der gemeinsame Text von AB*), wie manche wollen oder gewollt haben, notwendig oder tatsächlich das Werk eines einheitlichen Dichters, d. h. von éiner Hand in die Form gebracht, in der wir ihn lesen?
Ich habe diese Frage an der Hand ausgewählter Stichproben, und zwar auf Grund der stimmlichen Kriterien, wiederholt in Übungen untersuchen lassen, und wir sind dabei stets zu einem sehr entschiedenen Nein gekommen. Aber was sich uns daneben im einzelnen als positives Resultat zu ergeben schien, war doch zu kompliziert, als daß ich es ohne weitergehende Erprobung an größeren Textmassen in eine bestimmte Formel zu bringen wagte. Ich führe also wieder nur ein einzelnes Beispiel zur andeutenden Veranschaulichung des Verfahrens vor.
Die sechste Aventiure beginnt (nach der Abteilung von AD) mit der Strophe 325 B:
Iteniuwe maere sich huoben über Rîn.
man sagte daz dâ waere manec schoene magedîn.
der gedâhte im eine erwerben Gunther der künec guot:
da von begunde dem recken vil sêre hôhen der muot.
Diese Strophe ist melodisch ganz auf dem Kontrastprinzip aufgebaut, d.h. die Tonführung verläuft durchgehends in dipodischer Zickzackform (auf eine höhere Hebung folgt allemal eine tiefere, und umgekehrt). Dipo- dische Gliederung ist besonders deutlich in der 8. Halbzeile mit ihrem tiefen Einschnitt nach der zweiten Hebung (vil sê`re hô´- hèn der múot). Die Auftakte liegen konträr zu ihren Hebungen, d. h. vor tiefer Hebung liegt der Auftakt höher, vor höherer Hebung dagegen tiefer als die Hebung selbst. Besonders charakteristisch ist außerdem noch, daß die Aufmerksamkeit des Sprechenden über die Zäsur hinweg gespannt bleibt, d. h. daß die Töne der Schlußsilben vor der Zäsur als Vorbereitungstöne zu dem folgenden gesprochen werden, und nicht in sich abfallen, wie vor einer Pause oder am Satzschluß.
Es folgen die beiden schon früher charakterisierten Strophen 326 und 327:
Ez was ein küneginne gesezzen über sê.
ir gelîche enheine man wesse ninder mê.
diu was unmâzen schoene, vil michel was ir kraft:
si schôz mit snellen degenen umbe minne den schaft,
usw. Es fehlt darin die dipodische Zickzackbewegung der Melodiekurve, und insbesondere der Schnitt in der Schlußhalbzeile (vgl. namentlich 327,4 er hét dazhóubet sî´n verlórn mit 325,4 vil sê`re hô´- | hèn der múot). Es fehlt ferner die psychische Bindung über die Zäsur hinweg: die Schlußsilben vor der Zäsur haben die absinkenden Falltöne der Satzschlüsse (vgl. S. 102). Der ganze Vortrag ist, wie ebenfalls schon früher hervorgehoben, deutlich staccato, der Rhythmus stoßender als in 325, die Tonlage etwas nach oben hin verschoben, auch die Lage der Auftakte anders geregelt. Wir schließen also, daß 326 und 327 von einem andern Verfasser gedichtet sind, als 325.
Schwieriger ist Strophe 328:
Des het diu juncfrouwe unmâzen vil getân.
daz gehôrte bî dem Rîne ein ritter wol getân.
der wande sîne sinne an daz schoene wîp:
dar umbe muosen helede sît verliesen den lîp
Wir vermissen hier einheitliche Tonführung. In Z.1 und 4 finden wir die Zickzackbewegung der Tonkurve von 325 wieder, aber Z.2 und 3 haben glatte, schwach ansteigende Tonreihen, ähnlich wie 326 f., aber ohne das stoßende Staccato des Vortrags, und ohne das Herabsinken der letzten Hebung in der Langzeile, dafür aber mit (wenn auch schwach ausgeprägten) Bindetönen vor der Zäsur. Auch liegen in Z.1.4 unserer Strophe die Auftakte über, in 2. 3 unter der ersten Hebung. Mithin würden vermutlich Z.2 und 3 einer dritten Hand zuzuweisen sein, während Z.1 und 4 möglicherweise von dem Dichter von 325 stammen könnten. Ein selbständig arbeitender Dichter hätte ja auch wohl kaum ein Reimpaar wie vil getân: wol getân zustande gebracht (das denn auch A und I wieder wegkorrigiert haben). Auf jeden Fall dürfte die Strophe als uneinheitlich zu bezeichnen sein.
Wieder einheitlich ist dagegen die nächste Strophe, 329:
Dô sprach der vogt von Rîne „ich wil nider an den sê
hin ze Prünhilde, swie ez mir ergê.
ich wil durch ir minne wâgen mînen lîp:
den wil ich verliesen, sîne werde mîn wîp.“
Aber auch sie weicht bei näherer Betrachtung wieder von allen den Typen ab, die uns bisher begegnet sind, verrät also abermals eine neue Hand. Und dasselbe gilt auch wieder von Str. 330, und abermals von 331, und so weiter in bunter Folge. Wir finden also hier im engsten Raume ein gutes halbes Dutzend verschiedener melodischer Typen aneinander gedrängt vor, und mit ihnen ist die Zahl der Typen durchaus noch nicht abgeschlossen, die sich überhaupt wahrnehmen lassen.
Ein solches Resultat müßte vielleicht bedenklich machen und von weiterem Vorgehen in dieser Richtung abschrecken. Aber glücklicherweise liegen die Dinge nicht überall so schlimm wie hier: es kommen anderwärts doch auch umfänglichere Strophengruppen vor, die in geschlossener Folge einen und denselben Typus aufweisen. Man lese etwa beispielsweise in der zweiten Aventiure Str. 31—38, oder in der dritten (für einen andern Typus) Str. 129 (im Gegensatz zu 128 und 130) und dann weiter 131—137 (im Gegensatz zu 138): weiterhin in der vierten Aventiure 152—159. 161 (gegen 160) und 182—189, in der fünften Str. 276—280 u. dgl. mehr: ich glaube nicht, daß man innerhalb jeder einzelnen dieser Partien derartige Differenzen ermitteln kann, wie sie oben für den Beginn der sechsten Aventiure nachgewiesen wurden.
Das gibt uns denn doch wieder mehr Zutrauen, wenn wir auch für alle die einzelnen Hände, die an unserem
Nibelungentext Anteil haben, zunächst jedenfalls dieselbe individuelle Formkonstanz erwarten, die wir sonst bei Werken einheitlichen Ursprungs beobachten. Und dies Vertrauen wird fester, wenn wir weiterhin finden, daß sich die verschiedenen melodischen Typen auch in ein chronologisches System bringen lassen, d. h. also daß da, wo die Typen a bis x miteinander konkurrieren, a immer älter als b und dies älter als c ist usw., oder mit andern Worten, daß die einmal durch den Inhalt als jünger nachgewiesenen Typen überall die als älter bezeichneten voraussetzen, und zwar in ganz bestimmter Ordnung.
Verfolgt man dies weiter, so ergibt sich, daß unser B*-Text aus einer ganzen Reihe übereinander gelagerter Schichten aufgebaut ist, die sich wenigstens zu einem guten Teile noch voneinander trennen lassen. Schade nur, daß wir, vielleicht von der jüngsten abgesehen, kaum noch eine dieser Schichten in vollem Umfange werden aufdecken können. Denn (das wenigstens haben die angestellten Stichproben gelehrt) die späteren Überarbeiter älterer Stufen haben nicht nur zugesetzt, um zu erweitern, sondern öfters auch knappere Zwischenglieder gestrichen, um an deren Stelle ausführlicher zu berichten.
Damit schwindet denn auch die Aussicht, daß es möglich sein werde, den „ältesten“ Nibelungentext überhaupt noch annähernd lückenlos aus der Überlieferung herauszuschälen, wie das seinerzeit Lachmann unternommen hat, gestützt auf die Hypothese, daß der Wortlaut der „alten Lieder“ im überlieferten Text doch noch wesentlich getreu erhalten sei. Wir können nur — und diese Arbeit muß allerdings meiner Überzeugung nach nun mit neuen Hilfsmitteln noch einmal unternommen werden — versuchen, die aufgelagerten Textschichten eine nach der andern wieder abzutragen, und dadurch zu immer ursprünglicheren Fassungen zu gelangen. Aber je weiter wir dabei Vordringen, um so lückenhafter werden sich dabei voraussichtlich diese Residuärfassungen gestalten, da eben wohl jeder Nachfolger an dem Werk seiner Vorgänger auch zusammengestrichen hat, wo es ihm paßte, und daher der Satz gilt: je mehr Nachfolger, um so mehr Striche sind zu erwarten.
In dieser Halbnegative tritt also der durch die Untersuchung des Melodischen gewiesene Standpunkt zu dem Lachmanns in prinzipiellen Gegensatz. Mit Lachmanns Einzelkritik trifft dagegen die stimmlich-melodische Kritik in vielen Fällen zusammen, in vielen andern aber auch wieder nicht, oder nur in modifizierter Form. Wenn wir z. B. aus sprachmelodischen Gründen Str. 825 und 328 als das Werk zweier verschiedener Hände von den zu sammengehörigen 326 und 327 trennen mußten, so deckt sich das ganz mit Lachmanns Auffassung, und auch darin sind wir einig, daß wir die beiden letzteren Strophen (326 f.) der ältesten hier erreichbaren Schicht zuschreiben; ebenso darin, daß Str. 329 wieder älter ist als 328 und nachher 330 oder 331 usw. Aber darin muß ich von Lachmann abweichen, daß ich eben diese Strophe 329 nicht als „echt“ mit 326f. direkt verbinden kann; sie gehört nach dem Ausweis der Melodie wohl einer der älteren Schichten, aber doch noch nicht der Grundschicht an, der ich 326 f. zuweisen muß.
Doch ich muß endlich zum Schlusse gelangen. Gestatten Sie mir nur noch ein paar Bemerkungen allgemeinster Art.
Ich hoffe durch meine, wenn auch noch so fragmentarischen Erörterungen Ihnen doch gezeigt zu haben, daß und wie man mit den melodischen Kriterien arbeiten kann, ohne sich ins Subjektive zu verlieren. Die Erscheinungen aber, die ich besprochen habe, sind natürlich nicht auf das Deutsche beschränkt. Sie kehren mutatis mutandis in allen Literaturen wieder, die ich bisher zu gelegentlichen Vergleichen habe heranziehen können. Ich glaube daher auch, daß die hier für die niedere wie für die höhere Kritik der mittelhochdeutschen Texte empfohlenen Untersuchungsmethoden auch auf andern Gebieten, zumal auch dem der klassischen Philologie, entsprechende Resultate abwerfen würden. Was anders als den einzelnen Texten als solchen anhaftende innere musikalische Eigenschaften sollten denn z. B. daran schuld sein, daß jeder niederdeutsche Leser, sobald er unbefangen und ohne künstliches Pathos an Homer herantritt, etwa den Eingang der Ilias tiefer legt als den Schiffskatalog, und dem Eingang der Odyssee wieder ein anderes Niveau gibt, oder daß ihm bezüglich der Stimmlage z. B, Horaz-Vergil-Ovid ebenso eine aufsteigende Reihe bilden wie Catull-Tibull- Properz, und daß sich beim hochdeutschen Leser, sofern er noch auf der Basis des hochdeutschen Intonationssystems steht, das alles in sein Gegenteil umlegt? Oder warum liest man z. B. mit deutlicher Konträrabstufung in den Tonhöhen der Hebungen in der Ilias
Μήνιν άειδε, θεά, Πηληιάδεω ’Aχιλήος
ούλομένην, ή μυρί’ ’Aχαιοΐς άλγε’ εθηκεν,
aber mit glatten Tonreihen innerhalb der Halbzeilen bei der Odyssee
Άνδραμοιέννεπε, Μουσα | πολύτροπον, ϐςμάλαπολλά
πλάγχϑη, έπεΐΤροίης | ϊερονπτολίεϑρονεπερσεν,
und warum unterscheidet man etwa zwischen Euripides und Sophokles in gleichem Sinne? Oder endlich, warum wäre man sonst gezwungen, etwa in den Versen
έξούδήτάπρώταδιαστήτηνέρίσαντε
’Aτρεΐδηςτεάναξάνδρώνκαίδΐος ’Aχιλλεύς
aus dem sonstigen Niveau der Verse herauszugeraten (als Niederdeutscher nach unten, als Hochdeutscher nach oben), wenn man die viersilbige Form Άτρεΐδης durch die unhistorische Kontraktionsform Άτρείδης ersetzend lesen wollte
έξούδήτάπρώταδιαστήτηνέρίσαντε
’Aτρείδηςτεάναξάνδρώνκαίδΐος ’Aχιλλεύς
da doch der Spondäus an sich gleich nach Ausweis des ersten der beiden Verse nicht an der Tonverschiebung schuld sein kann? Ich weiß keine andere Antwort, als daß es sich bei allen den hier berührten Erscheinungen um immanente Eigenschaften aller Redeprodukte des menschlichen Geistes überhaupt handelt, und darum müssen sie auch sowohl von dem Psychologen wie von dem Ästhetiker wie von dem kritisch arbeitenden Philologen in den Kreis ihrer Arbeiten einbezogen werden. Möge es gemeinsamer Arbeit einst beschieden sein, nicht nur die wenigen hier gestreiften Fragen sicher zu beantworten, sondern auch die Rätsel zu lösen, die sich jetzt noch allüberall darbieten, wenn wir versuchen, von der Beobachtung des Tatsächlichen und seiner praktischen Verwertung zu der Frage nach den letzten Gründen dieser Dinge vorzuschreiten.
1 S. darüber die Vorbemerkung S. 5f.
2 Einiges Weitere hierzu s. in meiner Phonetik 5 § 654 ff.
3 Eine weitere Spezies von Selbstlesern ist mir erst neulich entgegengetreten, lange nachdem das Obenstehende geschrieben war. Wer diesen Dingen besonders hilflos gegenübersteht und sich in glücklichem Wahn doch stärker fühlt als andere Leute, der besteigt auch wohl das Roß der Selbstgerechtigkeit und sucht die Wissenschaft mit Geschrei vor der Unwissenschaft zu retten, statt mit Gründen. Besonders eifervolle Stilübungen in dieser Richtung s. neuestens im Anzeiger für deutsches Altertum 34, 222 ff. — Was würde man wohl dazu sagen, wenn sich die Farbenblinden zusammentäten, um den Normalsichtigen ihre Farbenempfindungen wegzudisputieren, weil sie sie nicht in gleicher Weise haben? In der Philologie aber dünkt sich ein Tauber der oben gekennzeichneten Art wohl gar eigens deswegen zum Richter berufen zu sein, weil er taub ist, oder weil er doch noch nicht gelernt hat, richtig zu hören, was um ihn herum vorgeht. — Womit ich mich übrigens selbstverständlich nicht auf jeden Einzelansatz bei Habermann oder irgendeinem anderen Beobachter festgelegt haben will: Irrtümer sind ja bei einer so schwierigen Sache überall möglich und zurzeit auch wohl noch unvermeidlich. Um so ernster und mit um so besserem Willen sollte man diesen denn doch wahrhaftig wichtigen Fragen zu Leibe gehen.
4 Gegenüber der Skepsis, welche dieser Anschauung auch in neuester Zeit noch von verschiedenen Seiten entgegengebracht wird, muß ich so schroff wie möglich betonen, daß die Sache selbst außer allem Zweifel steht. Zweifeln kann nur, wer nicht in der Lage gewesen ist, die Sprechweisen unbefangen und voraussetzungslos redender Nieder- und Hochdeutscher zu vergleichen, namentlich wenn er selbst einem derjenigen Gebiete angehört, wo das Schwanken zwischen den beiden Gebieten (s. oben S. 63) sozusagen endemisch ist. Als möglich zuzugeben ist nur dieses. Wie ich in meiner Phonetik5 §666 ausgeführt habe, sind nur die habituell bedingten Tonhöhengegensätze umlegbar, nicht die mechanisch bedingten (§ 665). Durch eine den Typus des Autors verlassende Umlegung wird also niemals ein ganz reines Resultat erzielt, sobald mechanisch bedingte Tonhöhendifferenzen in Frage kommen; es entstehen also in solchen Fällen sicherlich gewisse melodische Störungen, und es ist denkbar (wenn auch vorläufig noch nicht erwiesen), daß ein empfindliches Ohr diese instinktiv herausfindet und der Besitzer dieses Ohres dadurch getrieben wird, die betreffenden Stellen gegen seine eigene angestammte Weise im Sinne des ihm konträr liegenden Autors zu intonieren.
5 Zur Ergänzung möchte ich, um sonst möglichen Irrtümern vorzubeugen, hier noch zwei für die Kontrolle wesentliche Beobachtungen mitteilen. Die eine ist die, daß die typische Satzmelodie eines Autors jedesmal soviel Text umspannt, als er (und sein Leser nach ihm bei der Reproduktion) psychisch zusammennimmt. Es fallen daher nicht nur oft längere Satzgebilde zwangsweise in melodische Teilstücke (mit jeweils vollständiger Melodiekurve) auseinander, weil des Inhaltes zu viel oder zu verschiedenes ist, als daß man binden könnte; sondern man kann oft auch bindbare Stücke durch willkürliche Gliederung, eventuell durch Pausen, trennen. Auch dann pflegt jedes Teilstück, soweit es angeht, die volle Kurve zu bekommen, unter Umschiebung der charakteristischen Töne dieser Kurve auf entsprechend gelegene Silben des Teilstückes. — Fast noch wichtiger für die Praxis ist die zweite Beobachtung, weil sie eine Menge scheinbarer Anomalien aus dem Wege schafft. Oft scheinen nämlich die Melodiekurven einer Satzfolge nicht zu stimmen; beispielsweise beginnt da etwa der eine oder andere Satz gleich mit einem hohen Ton, während die Mehr zahl tief einsetzt und erst durch einen Steigschritt die Höhe erreicht. In solchen Fällen liegen aber doch nicht andere Kurven vor, sondern nur Teilstücke der Hauptkurve, und die fehlenden Stücke werden pausiert, damit man das Fehlende, wenn auch unbewußt, in Gedanken durchlaufen kann. Einem jeden Fehlstück der Hauptkurve entspricht also beim Vortrag eine Zwangspause, die man nicht ausschalten kann, ohne melodisch ins Stocken zu geraten. Bei der Beurteilung der Konstanz der Kurven sind diese Pausen natürlich stets mit zu berechnen.
6 Jedoch im allgemeinen nur, wenn man die beiden Halbzeilen auch im Vortrag zu einer (rhythmischen) Periode verbindet. Isoliert man die beiden Hälften der Periode voneinander, so bekommen sie, im Anschluß an das S. 98 in der Fußnote Bemerkte, beide die Kurve . · .; man spricht also z. B. isolierend (ohne den vorausgehenden Vordersatz) vielmehr Und si.nken ti·ef ins Mee.r und Trank ni.e einen Tro·pfen me.hr (bzw. umgekehrt bei hochdeutscher Intonation).
7 Man verkleinere bei mehrmaliger Wiederholung des Textes stufenweise sämtliche Intervalle, indem man gleichzeitig durch die Mittelstufe des Murmelns in ein bloßes Summen übergeht, bei dem schließlich alle betonteren Silben in ein und denselben Summton zusammenfallen. Das ist dann der gesuchte Durchschnittston.
8 Die fortgesetzte Untersuchung hat mir gezeigt, daß mit der Melodik allein nicht zum Ziel zu gelangen ist. Wesentlich weiter gelangt man schon durch die Herbeiziehung der Rutzschen Unterscheidungen verschiedener Stimmqualitäten bzw. der mit dem Wechsel der Stimmqualitäten (und Autoren) parallel gehenden verschiedenartigen Reaktionen der Rumpfmuskulatur. Auf diese kann ich aber hier natürlich nicht eingehen, ohne die ganze Art der Untersuchung auf einen Stand zu verschieben, den sie vor dem Bekanntwerden der Arbeiten von Josef Rutz und seiner Familie im Jahre 1908 nicht haben konnte. Überdies bleiben auch dann noch praktische Schwierigkeiten genug, wenn man Rutzsche Reaktionen benutzt.